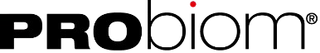Kaum ein Thema beschäftigt moderne Medizin und Gesellschaft so sehr wie der rasante Anstieg von Allergien. Während vor wenigen Jahrzehnten Heuschnupfen oder Nahrungsmittelallergien noch als selten galten, gehören sie heute für Millionen Menschen zum Alltag. Immer mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene reagieren auf Pollen, Hausstaub, Tierhaare oder bestimmte Nahrungsmittel. Laut aktuellen Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leidet fast jeder dritte Mensch in industrialisierten Ländern an mindestens einer allergischen Erkrankung – Tendenz steigend. Diese Entwicklung wirft eine entscheidende Frage auf: Warum werden Allergien immer häufiger? Die Antwort ist komplex. Sie liegt nicht nur in unseren Genen, sondern vor allem in unserer modernen Umwelt und Lebensweise. Unser Immunsystem ist nicht mehr denselben Reizen ausgesetzt wie früher – und das hat Folgen.
Was ist eine Allergie überhaupt?
Eine Allergie ist eine Überreaktion des Immunsystems auf eigentlich harmlose Substanzen – sogenannte Allergene. Diese können Pollen, Hausstaubmilben, Tierhaare, bestimmte Nahrungsmittel oder chemische Stoffe sein.
Normalerweise schützt das Immunsystem den Körper vor Krankheitserregern wie Viren oder Bakterien. Bei einer Allergie jedoch „verwechselt“ es harmlose Substanzen mit gefährlichen Eindringlingen. Es produziert Antikörper (IgE) gegen das Allergen und löst eine Entzündungsreaktion aus, sobald Kontakt besteht.
Diese Reaktion kann sich in vielfältiger Weise äußern – von Heuschnupfen, Hautausschlägen und Atembeschwerdenbis hin zu lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schocks.
Doch warum reagiert unser Immunsystem überhaupt so empfindlich? Die Antwort liegt in einem Zusammenspiel aus genetischen, umweltbedingten und lebensstilbezogenen Faktoren.
Der Anstieg der Allergien – ein Phänomen der Moderne
Die Zahl der Allergiker ist in den letzten 50 Jahren dramatisch gestiegen – besonders in westlichen Industrieländern. In ländlichen, weniger industrialisierten Regionen sind Allergien dagegen deutlich seltener.
Diese Entwicklung ist zu schnell verlaufen, um rein genetisch erklärbar zu sein. Unsere DNA hat sich in wenigen Jahrzehnten kaum verändert – unsere Umwelt jedoch grundlegend.
Wissenschaftler sprechen hier vom sogenannten „Allergie-Paradoxon“: Je sauberer, moderner und hygienischer unsere Lebensweise wird, desto häufiger treten allergische Erkrankungen auf.
Ursache 1: Die Hygienehypothese – zu sauber für unser eigenes Immunsystem
Eine der bekanntesten Theorien zur Zunahme von Allergien ist die Hygienehypothese. Sie besagt, dass unser Immunsystem in der frühen Kindheit zu wenig „Training“ bekommt, weil wir in einer übermäßig sauberen Umgebung aufwachsen.
Früher kamen Kinder regelmäßig mit Schmutz, Tieren und Mikroorganismen in Kontakt. Dadurch lernte das Immunsystem, harmlose und gefährliche Substanzen voneinander zu unterscheiden. Heute hingegen wachsen viele Kinder in nahezu sterilen Haushalten auf, mit antibakteriellen Reinigungsmitteln, pasteurisierten Lebensmitteln und weniger Kontakt zur Natur.
Das Ergebnis: Das Immunsystem wird unterfordert und reagiert überempfindlich auf harmlose Stoffe wie Pollen oder Nahrungsproteine. Studien zeigen, dass Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen oder viele Geschwister haben, seltener an Allergien leiden – vermutlich, weil ihr Immunsystem von klein auf vielfältige mikrobielle Reize erfährt.
Ursache 2: Das Mikrobiom – unser unsichtbares Ökosystem
Eng verbunden mit der Hygienehypothese ist das Konzept des Mikrobioms – der Gesamtheit aller Mikroorganismen, die auf und in unserem Körper leben. Besonders das Darmmikrobiom spielt eine zentrale Rolle für die Regulation des Immunsystems.
Ein vielfältiges, gesundes Mikrobiom hilft dabei, Immunreaktionen zu steuern und überschießende Entzündungen zu verhindern. Doch moderne Lebensgewohnheiten stören dieses Gleichgewicht:
Antibiotika, hochverarbeitete Lebensmittel, Kaiserschnittgeburten, übermäßige Hygiene und zu wenig Ballaststoffe führen dazu, dass viele Menschen heute eine verringerte mikrobielle Vielfalt im Darm aufweisen.
Diese Dysbalance kann dazu führen, dass das Immunsystem „fehlgeleitet“ wird – es verliert seine Toleranz gegenüber harmlosen Stoffen. Kinder, die früh Antibiotika erhalten oder mit dem Kaiserschnitt zur Welt kommen (und somit nicht mit den mütterlichen Vaginalbakterien in Kontakt kommen), haben statistisch ein höheres Risiko, Allergien zu entwickeln.
Ursache 3: Umweltverschmutzung und Klimawandel
Unsere Umwelt hat sich dramatisch verändert – und das wirkt sich direkt auf die Atemwege und das Immunsystem aus. Luftschadstoffe wie Feinstaub, Stickoxide oder Ozon reizen die Schleimhäute und machen sie durchlässiger für Allergene. Dadurch können Pollen, Hausstaub oder Schimmelsporen leichter in den Körper eindringen und dort Immunreaktionen auslösen.
Doch auch der Klimawandel trägt seinen Teil bei. Höhere Temperaturen verlängern die Pollensaison, Pflanzen blühen früher und produzieren mehr Pollen. Einige Studien zeigen zudem, dass erhöhte CO₂-Konzentrationen dazu führen, dass Pflanzen aggressivere Pollen mit stärker allergenem Potenzial bilden.
Das bedeutet: Menschen sind heute nicht nur länger, sondern auch intensiver allergenen Substanzen ausgesetzt – ein weiterer Faktor für den weltweiten Anstieg von Allergien.
Ursache 4: Ernährung im Wandel
Unsere Ernährung hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert. Industriell verarbeitete Lebensmittel, künstliche Zusatzstoffe und Zucker sind allgegenwärtig, während frische, ballaststoffreiche Kost aus Obst, Gemüse und Vollkornprodukten seltener auf den Tisch kommt.
Ballaststoffe sind jedoch die Hauptnahrung für die „guten“ Darmbakterien. Fehlen sie, leidet die mikrobielle Vielfalt – und damit auch die Immunbalance.
Zudem wird diskutiert, dass bestimmte Fettsäuremuster (etwa durch übermäßigen Konsum von Omega-6-Fettsäuren aus Pflanzenölen) entzündliche Prozesse im Körper fördern können. Auch Vitamin-D-Mangel, der durch weniger Sonnenexposition in modernen Lebensstilen häufig vorkommt, wird mit einem erhöhten Allergierisiko in Verbindung gebracht.
Kinder, die in den ersten Lebensjahren stark verarbeitete Kost erhalten oder zu wenig Kontakt zu natürlichen Lebensmitteln haben, entwickeln häufiger Nahrungsmittelallergien. Studien belegen, dass die frühe Einführung potenzieller Allergene (wie Erdnüsse oder Eier) schützende Effekte haben kann – im Gegensatz zur früher propagierten Vermeidung.
Ursache 5: Lebensstil und Stress
Auch psychologische und soziale Faktoren spielen eine zunehmend wichtige Rolle. Chronischer Stress, Schlafmangel und ein hohes Maß an Umweltbelastung wirken sich direkt auf das Immunsystem aus.
Das Stresshormon Cortisol beeinflusst Immunzellen und Entzündungsprozesse. Dauerstress kann die Immunregulation stören und die Barrierefunktionen von Haut und Schleimhäuten schwächen.
Menschen, die unter dauerhaftem Stress leiden, neigen häufiger zu Hauterkrankungen, Asthma oder allergischen Reaktionen. Auch Bewegungsmangel und Übergewicht tragen zur Entstehung chronischer Entzündungszustände bei, die Allergien begünstigen.
Ursache 6: Der Verlust natürlicher Reize
Unser Körper ist evolutionär darauf ausgelegt, in engem Kontakt mit der Natur zu leben – mit Erde, Pflanzen, Mikroben und wechselnden Umweltbedingungen. Doch in der modernen, urbanisierten Welt verbringen viele Menschen bis zu 90 % ihrer Zeit in geschlossenen Räumen.
Dieser Verlust an Umweltvielfalt hat Folgen für das Immunsystem. Kinder, die auf dem Land aufwachsen, kommen mit einer größeren Bandbreite von Mikroorganismen in Kontakt und entwickeln seltener Allergien. Stadtbewohner dagegen sind stärker Schadstoffen ausgesetzt und leben in mikrobiologisch „armen“ Umgebungen.
Forscher sprechen vom „Biodiversity-Hypothesis“ – also der Annahme, dass der Verlust an Umwelt- und Artenvielfalt direkt mit der Zunahme von Allergien und Autoimmunerkrankungen zusammenhängt.
Ursache 7: Genetische Prädisposition
Auch wenn Umwelt- und Lebensstilfaktoren entscheidend sind, dürfen genetische Einflüsse nicht außer Acht gelassen werden. Menschen, deren Eltern oder Geschwister an Allergien leiden, haben ein erhöhtes Risiko, selbst betroffen zu sein.
Die genetische Komponente erklärt, wer anfällig ist – aber nicht, warum immer mehr Menschen betroffen sind. Erst das Zusammenwirken von genetischer Veranlagung und modernen Umweltbedingungen führt zur massenhaften Zunahme allergischer Erkrankungen.
Was wir daraus lernen können
Der Anstieg der Allergien ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer tiefgreifenden Veränderung unserer Umwelt und Lebensweise. Unsere Körper – und insbesondere unser Immunsystem – sind evolutionär auf eine Welt angepasst, die es so nicht mehr gibt.
Statt uns mit Keimen, Erde und unverarbeiteten Lebensmitteln auseinanderzusetzen, leben wir in einer kontrollierten, sterilen und chemisch dominierten Umgebung. Das führt zu einer Entkopplung zwischen uns und den natürlichen Reizen, die unser Immunsystem einst geformt haben.
Doch die gute Nachricht ist: Wir können aktiv gegensteuern.
Wie man sein Allergierisiko senken kann
Eine komplette Vorbeugung ist zwar nicht möglich, aber es gibt wissenschaftlich belegte Wege, das Risiko zu reduzieren und bestehende Allergien zu mildern.
Dazu gehören regelmäßige Bewegung an der frischen Luft, eine ballaststoffreiche, natürliche Ernährung, bewusster Umgang mit Antibiotika und ausreichend Schlaf. Auch Kinder profitieren von frühzeitigem Kontakt mit natürlichen Umweltkeimen – sei es durch Spielen im Garten, den Kontakt mit Tieren oder das Leben auf dem Land.
Zudem ist es wichtig, das Mikrobiom zu unterstützen: durch fermentierte Lebensmittel wie Joghurt, Kefir oder Sauerkraut, durch Probiotika und durch eine Ernährung mit vielen pflanzlichen Ballaststoffen.
Langfristig gilt: Je natürlicher und vielfältiger unser Lebensstil, desto ausgeglichener unser Immunsystem.
Fazit
Allergien sind ein Spiegelbild unserer modernen Lebensweise. Der Mensch hat sich von vielen natürlichen Reizen entfremdet, die einst sein Immunsystem geprägt haben. Saubere Städte, sterile Haushalte, veränderte Ernährung, Umweltverschmutzung und Stress führen dazu, dass unser Immunsystem fehlgeleitet reagiert – auf Dinge, die eigentlich harmlos sind.
Der Schlüssel liegt darin, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Mehr Natur, weniger künstliche Eingriffe, ein respektvoller Umgang mit Mikroben und eine bewusste Lebensweise können helfen, das Immunsystem zu stabilisieren.
Allergien sind also kein unvermeidbares Schicksal – sie sind eine Herausforderung, die uns daran erinnert, wieder im Einklang mit unserer Umwelt zu leben.
FAQ – Häufig gestellte Fragen
Warum entwickeln Kinder heute häufiger Allergien als früher?
Kinder wachsen heute oft in übermäßig sauberen Umgebungen auf und haben weniger Kontakt mit Mikroben. Das führt dazu, dass ihr Immunsystem zu wenig trainiert wird und überempfindlich reagiert.
Kann man Allergien durch Ernährung beeinflussen?
Ja, eine ballaststoffreiche, natürliche Ernährung fördert eine gesunde Darmflora, die wiederum das Immunsystem stärkt. Zu viel Zucker, Fett und verarbeitete Produkte können dagegen Entzündungen fördern.
Hat der Klimawandel wirklich Einfluss auf Allergien?
Ja. Er verlängert die Pollensaison, erhöht die Pollenkonzentration und verändert die Zusammensetzung der Allergene. Dadurch treten Symptome häufiger und stärker auf.
Was kann man tun, um das Allergierisiko bei Kindern zu senken?
Früher Kontakt mit natürlichen Mikroben, ausgewogene Ernährung, Stillen, moderate Hygiene und eine zuckerarme Lebensweise helfen, das Immunsystem zu trainieren.
Können Allergien wieder verschwinden?
In manchen Fällen ja. Durch Desensibilisierung, Darmgesundheit und veränderte Lebensweise können sich allergische Reaktionen abschwächen oder ganz zurückbilden – das hängt jedoch vom individuellen Immunsystem ab.