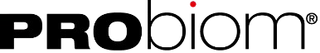Divertikulitis ist eine Erkrankung des Dickdarms, bei der sich kleine Ausstülpungen der Darmwand – sogenannte Divertikel – entzünden. Was viele jedoch nicht wissen: Neben den körperlichen Beschwerden wie Schmerzen, Blähungen und Verdauungsproblemen kann die Erkrankung auch die Psyche stark beeinflussen – und umgekehrt. In diesem Beitrag beleuchten wir die wechselseitige Beziehung zwischen Darm und Seele und zeigen Wege zu einem ganzheitlichen Umgang mit Divertikulitis auf.
Was ist Divertikulitis?
Divertikel entstehen typischerweise im Bereich des Colon sigmoideum durch eine Ausstülpung der Mukosa und Submukosa durch Muskellücken in der Darmwand. Diese Divertikulose bleibt häufig asymptomatisch, kann jedoch im Falle einer bakteriellen oder mechanischen Reizung in eine akute oder chronisch-rezidivierende Divertikulitis übergehen.
Typische Symptome einer akuten Divertikulitis sind Schmerzen im linken Unterbauch, Fieber, Leukozytose, sowie Stuhlveränderungen. Bei komplizierten Verläufen können Perforationen, Abszesse, Fisteln oder Stenosen auftreten. Die Behandlung reicht von konservativer medikamentöser Therapie bis hin zur operativen Sanierung.
Die Darm-Hirn-Achse: Kommunikation zwischen Bauch und Kopf
Der menschliche Darm verfügt über ein autonom arbeitendes Nervensystem – das enterische Nervensystem (ENS) –, das eng mit dem zentralen Nervensystem (ZNS) vernetzt ist. Über die sogenannte Darm-Hirn-Achse findet ein kontinuierlicher Informationsaustausch statt, der sowohl neuronal (über den Nervus vagus), als auch hormonell und immunologisch vermittelt wird.
Psychische Belastungen wie chronischer Stress, Angststörungen oder depressive Erkrankungen beeinflussen das gastrointestinale System über die Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA-Achse) und die Freisetzung von Stresshormonen wie Kortisol. Diese können die Darmbarriere schwächen, die Darmmotilität verändern und entzündungsfördernde Prozesse verstärken – ein Risikofaktor für die Entstehung und Exazerbation einer Divertikulitis.
Divertikulitis und das Mikrobiom
Die Divertikulitis steht zunehmend im Fokus der Forschung im Zusammenhang mit dem intestinalen Mikrobiom. Während Divertikelbildung primär mit strukturellen Veränderungen der Darmwand und Lebensstilfaktoren wie ballaststoffarmer Ernährung in Verbindung gebracht wird, deuten aktuelle Studien darauf hin, dass eine Dysbiose – also ein Ungleichgewicht in der Zusammensetzung der Darmmikroben – eine entscheidende Rolle bei der Entstehung und dem Verlauf der Divertikulitis spielt. Veränderungen in der bakteriellen Vielfalt, insbesondere eine Abnahme protektiver Arten und eine Zunahme entzündungsfördernder Keime, scheinen die lokale Immunantwort zu verstärken und chronische Entzündungen zu begünstigen. Dies erklärt auch, warum probiotische und diätetische Ansätze zur Stabilisierung des Mikrobioms zunehmend als Ergänzung zu klassischen Therapien wie Antibiotika und chirurgischen Maßnahmen diskutiert werden.
Psychische Folgen der Divertikulitis
Die wiederkehrenden Beschwerden und Einschränkungen, die mit einer chronischen Divertikulitis einhergehen, wirken sich ihrerseits belastend auf die psychische Gesundheit aus. Betroffene berichten häufig über Angst vor Nahrungsaufnahme, soziale Isolation, Hilflosigkeit und eine eingeschränkte Lebensqualität. Nicht selten entwickeln sich depressive Verstimmungen oder Angststörungen im Kontext der Erkrankung.
Zudem kann eine erhöhte viszerale Schmerzempfindlichkeit (Hyperalgesie), begünstigt durch psychische Stressoren, die subjektive Wahrnehmung von Beschwerden verstärken, ohne dass eine objektive Verschlechterung der organischen Befunde vorliegt. Diese Überlappung mit funktionellen gastrointestinalen Störungen – wie dem Reizdarmsyndrom – erschwert die Diagnostik und Therapie.
Ganzheitliche Therapieansätze
Eine erfolgreiche Behandlung der Divertikulitis sollte nicht ausschließlich auf die entzündungshemmende und antibiotische Therapie beschränkt sein. Auch die psychische Komponente sollte frühzeitig identifiziert und in die Therapie integriert werden.
Zu den empfehlenswerten Maßnahmen zählen:
-
Psychotherapeutische Interventionen, insbesondere bei begleitenden Angst- oder depressiven Symptomen
-
Stressreduktionstechniken wie Achtsamkeit, Meditation, progressive Muskelrelaxation oder Yoga
-
Verhaltensmedizinische Begleitung, um krankheitsfördernde Denk- und Verhaltensmuster zu erkennen und zu verändern
-
Ernährungsberatung zur Umstellung auf eine ballaststoffreiche, antiinflammatorische Kost
-
Bewegungstherapie zur Förderung der Darmmotilität und Reduktion psychischer Spannungszustände
Auch die gezielte Modulation des Mikrobioms durch prä- und probiotische Strategien kann unterstützend wirken, da das intestinale Mikrobiom nachweislich Einfluss auf sowohl immunologische Prozesse als auch die psychische Stabilität hat.
Probiotika und Divertikulitis
Probiotika werden bei Divertikulitis zunehmend als ergänzende Therapieoption diskutiert. Während die klassische Behandlung in akuten Fällen auf Antibiotika und entzündungshemmende Maßnahmen setzt, liegt der Fokus von Probiotika auf der Stabilisierung des Mikrobioms. Durch den gezielten Einsatz bestimmter Bakterienstämme kann das Gleichgewicht im Darm wiederhergestellt, das Immunsystem moduliert und die Schleimhautbarriere gestärkt werden. Erste Studien zeigen, dass Probiotika nicht nur die Beschwerden wie Blähungen, Schmerzen oder Stuhlunregelmäßigkeiten lindern können, sondern möglicherweise auch das Risiko für erneute Entzündungsschübe senken. Besonders interessant ist ihr Einsatz in der Remissionsphase, also in der beschwerdefreien Zeit nach einer akuten Entzündung, um Rückfällen vorzubeugen. Auch wenn die wissenschaftliche Datenlage noch nicht ausreicht, um Probiotika als Standardtherapie zu empfehlen, gelten sie in der Praxis als gut verträglich und können eine wertvolle Ergänzung zur Ernährungsumstellung und ärztlichen Behandlung sein. Weitere Infos zu Probiotika und Divertikulitis findest Du in unserem Beitrag Können Probiotika bei Divertikulitis helfen?
Fazit
Die Divertikulitis ist nicht nur eine lokale Entzündung des Darms, sondern Ausdruck eines komplexen Zusammenspiels zwischen gastrointestinalen, immunologischen und psychischen Faktoren. Die Beachtung der bidirektionalen Darm-Hirn-Kommunikation ist essenziell für ein umfassendes Verständnis und eine nachhaltige Behandlung der Erkrankung.
Ein interdisziplinärer Ansatz, der gastroenterologische, ernährungsmedizinische und psychosomatische Komponenten verbindet, stellt die Grundlage einer patientenzentrierten Therapie dar. Nur so kann sowohl die körperliche als auch die seelische Belastung reduziert und die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig verbessert werden.