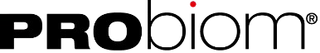Neurodermitis, auch bekannt als atopische Dermatitis, ist eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung, die Millionen Menschen weltweit betrifft. Typische Symptome wie Juckreiz, Rötungen, schuppige Haut und wiederkehrende Entzündungsschübe belasten Betroffene sowohl physisch als auch psychisch. Während genetische Faktoren und Umweltreize als Auslöser bekannt sind, rückt ein weiterer Aspekt zunehmend in den wissenschaftlichen Fokus: das Hautmikrobiom.
In den letzten Jahren haben Studien eindrucksvoll gezeigt, dass das Hautmikrobiom bei Menschen mit Neurodermitis deutlich verändert ist. Diese mikrobielle Dysbalance – auch Dysbiose genannt – trägt maßgeblich zur Entstehung und Verschlimmerung der Symptome bei. Der folgende Beitrag beleuchtet ausführlich die Unterschiede zwischen dem Hautmikrobiom gesunder Menschen und dem bei Neurodermitis, zeigt wissenschaftlich fundierte Ursachen auf und stellt wirkungsvolle, mikrobiomfreundliche Pflege- und Behandlungsansätze vor.
Was ist das Hautmikrobiom?
Das Hautmikrobiom bezeichnet die Gesamtheit aller Mikroorganismen – Bakterien, Pilze, Viren und Milben –, die auf unserer Haut leben. Dieses mikrobiotische Ökosystem übernimmt essenzielle Aufgaben:
-
Es schützt vor pathogenen Keimen,
-
reguliert die Hautabwehr,
-
unterstützt die Barrierefunktion der Haut,
-
und erhält den leicht sauren pH-Wert.
Bei gesunder Haut besteht ein Gleichgewicht zwischen nützlichen und potenziell schädlichen Mikroorganismen. Dieses Gleichgewicht ist individuell, aber relativ stabil – solange es nicht durch äußere Einflüsse oder Krankheiten gestört wird.
Hautmikrobiom bei gesunder Haut vs. Neurodermitis
Menschen mit Neurodermitis zeigen im Vergleich zu Gesunden eine deutlich veränderte mikrobielle Zusammensetzung auf der Haut. Hier eine tabellarische Übersicht der wichtigsten Unterschiede:
| Merkmal | Gesunde Hautmikrobiota | Hautmikrobiom bei Neurodermitis |
|---|---|---|
| Mikrobielle Vielfalt | Hoch, vielfältige Bakterien- und Pilzarten | Stark reduziert, Dominanz weniger Spezies |
| Hauptbakterienarten | Staphylococcus epidermidis, Cutibacterium acnes | Staphylococcus aureus, reduzierte Diversität |
| pH-Wert der Haut | 4,5–5,5 (leicht sauer) | Erhöht, basischer Bereich |
| Hautbarriere | Intakt, funktionale Lipidschicht | Gestört, erhöhte Transepidermale Wasserverlust |
| Immunantwort | Gut reguliert | Überaktiviert, entzündlich |
| Kolonisation durch S. aureus | Selten und in geringen Mengen | Häufig, oft dominante Bakterienart |
Diese Veränderungen führen zu einem Teufelskreis: Die gestörte Hautbarriere begünstigt das Wachstum schädlicher Keime wie Staphylococcus aureus, die wiederum Entzündungen fördern und die Barriere weiter schädigen.
Die zentrale Rolle von Staphylococcus aureus bei Neurodermitis
Ein zentrales Problem bei Neurodermitis ist die übermäßige Besiedlung der Haut mit Staphylococcus aureus. Dieser Keim ist bei über 90 % der Neurodermitis-Betroffenen nachweisbar – im Vergleich zu nur etwa 10–20 % in der gesunden Bevölkerung.
S. aureus produziert Toxine, sogenannte Superantigene, die eine übermäßige Aktivierung des Immunsystems auslösen. Dadurch entstehen Entzündungen, Juckreiz und eine weitere Schwächung der Hautbarriere. Zudem verdrängt der Keim nützliche Bakterienarten wie Staphylococcus epidermidis, die normalerweise entzündungshemmende Substanzen produzieren und das Wachstum von S. aureus hemmen würden.
Ursachen der mikrobiellen Dysbiose bei Neurodermitis
Genetische Disposition
Ein Großteil der Betroffenen trägt Mutationen im Filaggrin-Gen, das für die Produktion von Strukturproteinen in der Haut verantwortlich ist. Ein Mangel an Filaggrin führt zu einer gestörten Barrierefunktion – was Mikroben leichter in die Haut eindringen lässt und das Gleichgewicht der Hautflora destabilisiert.
Übermäßige Hygiene
Die intensive Verwendung von Seifen, Desinfektionsmitteln und aggressiven Reinigern kann nützliche Bakterien abtöten und die mikrobielle Vielfalt reduzieren. Besonders bei Kindern mit Neurodermitis kann übertriebene Hygiene den natürlichen Aufbau des Mikrobioms verhindern.
Umweltfaktoren
Trockene Heizungsluft, Luftverschmutzung und Klimaveränderungen beeinflussen die Hautfeuchtigkeit und damit auch die Lebensbedingungen der Mikroorganismen auf der Haut. Häufige Duschen oder Baden mit heißem Wasser verschärfen das Problem.
Antibiotika-Therapien
Antibiotika – ob lokal oder systemisch – beseitigen nicht nur krankmachende Keime, sondern auch schützende Hautbakterien. Das macht Platz für resistente oder aggressive Erreger, insbesondere S. aureus.
Ernährung und Darmmikrobiom
Aktuelle Forschung zeigt, dass das Darmmikrobiom in engem Zusammenhang mit der Hautgesundheit steht. Dysbiosen im Darm – etwa durch unausgewogene Ernährung oder Medikamente – können systemische Entzündungen begünstigen und das Hautmikrobiom negativ beeinflussen.
Mikrobenfreundliche Pflege bei Neurodermitis: Was wirklich hilft
1. Milde, pH-hautneutrale Reinigung
Verwende nur seifenfreie Waschlotionen mit einem pH-Wert von 4,5–5,5. Diese unterstützen den natürlichen Säureschutzmantel und fördern das Wachstum nützlicher Bakterien. Achte auf Produkte ohne Duftstoffe, Alkohol und synthetische Konservierungsmittel.
2. Präbiotische und postbiotische Pflege
Präbiotika dienen als "Nahrung" für nützliche Hautbakterien. Sie helfen, das Gleichgewicht zu stabilisieren und schädliche Keime zurückzudrängen. Postbiotika – etwa Milchsäure oder Fermentextrakte – wirken direkt antientzündlich und regenerierend.
3. Fermentierte Kosmetikprodukte
Fermentierte Inhaltsstoffe wie Lactobacillus-Ferment oder Bifida-Ferment-Lysate fördern nachweislich ein gesundes Hautmikrobiom, verbessern die Barrierefunktion und reduzieren Hautrötungen. Diese Produkte sind ideal für empfindliche Hauttypen wie bei Neurodermitis.
4. Probiotika und Symbiotika von innen
Die orale Einnahme von Probiotika (z. B. Lactobacillus rhamnosus GG) kann sich positiv auf das Immunsystem und die Hautgesundheit auswirken. Studien zeigen, dass bestimmte Bakterienstämme Entzündungsschübe reduzieren und die Hautbarriere stärken können.
5. Feuchtigkeitspflege mit hautähnlichen Lipiden
Cremes mit Ceramiden, Phytosphingosinen und Omega-3-Fettsäuren helfen, die geschädigte Hautbarriere zu reparieren. Dadurch wird das Hautmikrobiom langfristig stabilisiert.
6. Reduktion von Triggerfaktoren
Vermeide übermäßige Hygiene, starkes Schwitzen, synthetische Kleidung und Stress – all das kann das Mikrobiom zusätzlich destabilisieren. Natürliche Materialien, kühle Duschen und Entspannungstechniken helfen, die Haut zu beruhigen.
Innovative Ansätze aus der Mikrobiomforschung
In der dermatologischen Forschung entstehen neue Therapien, die gezielt das Hautmikrobiom modulieren:
-
Bakterientherapie: Erste klinische Studien setzen gezielt hautfreundliche Stämme wie Staphylococcus hominisein, um S. aureus zu verdrängen.
-
Mikrobiom-basierte Cremes: Kosmetikhersteller entwickeln Produkte, die lebende oder inaktive probiotische Bakterien enthalten und die mikrobielle Vielfalt gezielt erhöhen.
-
Transplantation von Hautmikrobiom: Ein noch experimenteller Ansatz ist die Übertragung gesunder Hautflora auf betroffene Areale – ähnlich wie bei der Darmflora-Transplantation.
Fazit: Neurodermitis ist auch eine mikrobielle Erkrankung
Das Hautmikrobiom spielt eine Schlüsselrolle bei der Entstehung und Behandlung von Neurodermitis. Eine gestörte Hautflora – gekennzeichnet durch eine Dominanz von Staphylococcus aureus und eine reduzierte Diversität – führt zu Entzündung, Barrierestörung und chronischem Juckreiz. Durch gezielte, mikrobiomfreundliche Pflege, probiotische Ansätze und einen ganzheitlichen Lebensstil lässt sich dieser Teufelskreis durchbrechen.
Für Betroffene bedeutet das: Nicht nur cremen, sondern das Ökosystem Haut ganzheitlich verstehen und stärken – von außen wie von innen.