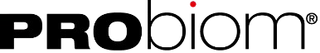Mundgeruch ist mehr als nur ein unangenehmer Begleiter: Er kann Beziehungen belasten, das Selbstbewusstsein untergraben und im Berufsleben zu Unsicherheit führen. Dabei liegt die Ursache in den meisten Fällen nicht in einer mangelnden Hygiene, sondern in einem mikrobiellen Ungleichgewicht der Mundflora.
In den letzten Jahren haben sich sogenannte orale Probiotika – insbesondere Streptococcus salivarius K12 und M18 – als vielversprechender Ansatz erwiesen, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen.
Sie sollen dabei helfen, die geruchsbildenden Bakterien zurückzudrängen, flüchtige Schwefelverbindungen (VSCs) zu reduzieren und die Mundgesundheit langfristig zu verbessern.
Doch funktioniert das wirklich? Dieser Beitrag beleuchtet die wissenschaftliche Grundlage, erklärt die bakteriellen Ursachen von Mundgeruch und zeigt, was klinische Studien über die Wirksamkeit dieser speziellen Probiotika verraten.
Mundgeruch – ein mikrobiologisches Problem, das tief in der Zunge sitzt
Etwa jeder vierte Erwachsene leidet regelmäßig unter Mundgeruch. Für Zahnärzte ist das längst kein Randthema mehr: Halitosis gehört heute zu den häufigsten Gründen für einen Zahnarztbesuch – gleich nach Karies und Parodontitis. In über 85 Prozent aller Fälle entsteht der schlechte Atem direkt im Mundraum (intraorale Halitosis).
Die wichtigste Ursache sind Bakterien auf der Zungenoberfläche, besonders im hinteren Bereich der Zunge, wo sich organische Ablagerungen aus Speiseresten, abgestorbenen Zellen und Schleim ansammeln. Dort finden anaerobe Bakterien wie Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis oder Prevotella intermedia ideale Lebensbedingungen: wenig Sauerstoff, viel Protein, konstante Feuchtigkeit.
Diese Mikroorganismen verstoffwechseln schwefelhaltige Aminosäuren wie Cystein und Methionin und setzen dabei flüchtige Schwefelverbindungen frei – vor allem Wasserstoffsulfid (H₂S), Methylmercaptan (CH₃SH) und Dimethylsulfid (CH₃SCH₃). Diese Gase sind hochflüchtig und charakteristisch für den typischen „faulen“ oder „schwefeligen“ Geruch von Mundgeruch.
Je nach beteiligter Bakterienart variiert die Geruchsqualität: Während Fusobacterium nucleatum eher faulig-süßlich riechende Verbindungen produziert, sind Porphyromonas gingivalis und Tannerella forsythia für besonders intensive, „verwesungsartige“ Noten verantwortlich.
Auch Zahnfleischerkrankungen (Gingivitis, Parodontitis) verstärken den Effekt, weil sie Taschen bilden, in denen sich anaerobe Bakterien dauerhaft einnisten können.
Dazu kommt: Ein verminderter Speichelfluss – etwa durch Stress, Medikamente oder nächtliches Atmen durch den Mund – verschlechtert die Selbstreinigung und erlaubt den pathogenen Keimen, sich weiter auszubreiten.
Das Konzept der oralen Probiotika
Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die, in ausreichender Menge aufgenommen, gesundheitliche Vorteile bringen. Im Darmbereich ist das längst etabliert – man denke an Lactobacillus- oder Bifidobakterien-Stämme in Joghurts oder Nahrungsergänzungsmitteln.
Doch der Mundraum ist ebenso ein mikrobielles Ökosystem – und genau hier setzen orale Probiotika an.
Statt die Darmflora zu beeinflussen, sollen sie direkt im Mund wirken: auf der Zunge, dem Zahnfleisch, den Wangen und im Speichel. Ziel ist es, ein gesundes mikrobielles Gleichgewicht wiederherzustellen, indem „gute“ Bakterien die „schlechten“ verdrängen, schädliche Stoffwechselprodukte hemmen und gleichzeitig das Immunsystem lokal modulieren.
Ein besonders interessanter Bewohner dieses Ökosystems ist Streptococcus salivarius – ein Bakterium, das natürlicherweise im Mund gesunder Menschen vorkommt und als einer der ersten Keime den Neugeborenenmund besiedelt. Von ihm stammen die beiden wissenschaftlich am besten untersuchten Stämme K12 und M18.
Beide werden seit Jahren in Studien untersucht und in Lutschtabletten, Kapseln oder Mundspülungen verarbeitet.
Sie gelten als sicher, sind geschmacksneutral und können die Mundflora über Wochen stabil beeinflussen.
Streptococcus salivarius K12 – der Spezialist gegen Mundgeruch
Der Stamm Streptococcus salivarius K12 wurde ursprünglich aus der Mundhöhle eines gesunden Erwachsenen isoliert, der kaum bakterielle Beläge aufwies und nie unter Mundgeruch litt. Forscher entdeckten, dass dieser Stamm Bacteriocineproduziert – natürliche antimikrobielle Peptide, die pathogene Keime gezielt hemmen, ohne das gesamte Ökosystem zu zerstören.
K12 bildet unter anderem Salivaricin A2 und Salivaricin B, die gegen verschiedene anaerobe Bakterien wirken, darunter jene, die für Halitosis verantwortlich sind. Diese Substanzen wirken, indem sie die Zellmembran der Zielbakterien destabilisieren, deren Stoffwechsel stören und schließlich deren Wachstum stoppen.
Interessanterweise reduziert K12 nicht nur die Bakterienzahl selbst, sondern auch deren Stoffwechselprodukte:
In klinischen Studien konnten Probanden, die über mehrere Tage K12-Lutschtabletten einnahmen, eine deutliche Reduktion der VSC-Konzentration im Atem nachweisen.
Die Wirkung zeigte sich schon nach wenigen Tagen und hielt bei fortgesetzter Anwendung über Wochen an.
Ein weiterer Mechanismus liegt in der Kolonisation der Mundschleimhaut: K12 kann sich an die Zungenoberfläche und die Wangenmukosa anheften. Dadurch entsteht eine Art „biologischer Schutzfilm“, der die Wiederbesiedlung durch geruchsbildende Keime erschwert.
Zudem zeigen Laborstudien, dass K12 entzündliche Prozesse modulieren kann: Er senkt die Freisetzung proinflammatorischer Zytokine (z. B. IL-6, IL-8), die in entzündetem Zahnfleisch überaktiv sind. Damit wird nicht nur Mundgeruch bekämpft, sondern auch ein Beitrag zur allgemeinen Parodontalgesundheit geleistet.
Streptococcus salivarius M18 – mehr als frischer Atem
Während K12 primär auf Halitosis zielt, ist Streptococcus salivarius M18 für seine Wirkung auf Halitosis, Plaque und Zahnfleischgesundheit bekannt.
Dieser Stamm produziert neben Bacteriocinen auch Enzyme wie Dextranasen und Urease, die in der Lage sind, Zahnplaque biologisch abzubauen und den pH-Wert im Mund zu stabilisieren.
Dadurch verhindert M18, dass sich pathogene Biofilme bilden – jene klebrigen Bakteriengemeinschaften, die Karies, Gingivitis und Parodontitis fördern.
Da die Entzündung des Zahnfleisches häufig mit verstärktem Mundgeruch einhergeht, ist M18 auch indirekt ein wirksames Mittel gegen Halitosis.
In klinischen Doppelblindstudien zeigte sich, dass Probanden, die über mehrere Wochen M18-Lutschtabletten einnahmen, signifikant weniger Zahnfleischentzündungen und Plaqueablagerungen aufwiesen als die Kontrollgruppe. Parallel sank auch die Konzentration flüchtiger Schwefelverbindungen im Atem – ein indirekter Hinweis auf die Reduktion geruchsbildender Keime.
M18 wirkt somit wie ein „Mikro-Manager“ im Mund: Er reguliert nicht nur das bakterielle Gleichgewicht, sondern sorgt auch für eine gesündere Umgebung, in der pathogene Arten schwerer überleben.
Der Wirkmechanismus – wie Probiotika Mundgeruch wirklich bekämpfen
Der Erfolg oraler Probiotika lässt sich durch ein Zusammenspiel mehrerer Mechanismen erklären.
Zunächst verdrängen K12 und M18 pathogene Bakterien durch Konkurrenz um Nährstoffe und Anheftungsstellen. Sie bilden dabei mikroskopisch kleine Kolonien, die sich fest an der Schleimhaut verankern und so verhindern, dass halitogene Keime wie Fusobacterium oder Prevotella andocken können.
Gleichzeitig produzieren beide Stämme antimikrobielle Peptide, die spezifisch gegen geruchsbildende Bakterien wirken. Diese sogenannten Bacteriocine sind evolutionär so fein abgestimmt, dass sie nur bestimmte Arten hemmen, während andere – harmlose oder nützliche – Arten ungestört bleiben.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Regulierung des lokalen Immunsystems:
Probiotika aktivieren regulatorische Signalwege, die übermäßige Entzündungsreaktionen dämpfen. Dadurch sinkt die Freisetzung von entzündungsfördernden Botenstoffen im Zahnfleischgewebe, was langfristig zu weniger Schwellung, weniger Blutungen und einer gesünderen Mundflora führt.
Auch der pH-Wert im Speichel wird positiv beeinflusst. M18 produziert Urease, ein Enzym, das Harnstoff in Ammoniak umwandelt und dadurch Säuren neutralisiert. Ein stabilerer pH-Wert hemmt säureliebende, pathogene Keime und begünstigt neutrale Milieus, in denen nützliche Bakterien gedeihen.
Das Ergebnis ist eine umfassende ökologische Neuausrichtung: weniger Geruch, weniger Entzündung, weniger Plaque – und langfristig ein gesünderes orales Mikrobiom.
Klinische Evidenz – was sagen die Studien?
Die Wirksamkeit von Streptococcus salivarius K12 und M18 ist in den letzten Jahren mehrfach untersucht worden – sowohl in Laborversuchen als auch in klinischen Studien.
Eine der bekanntesten Untersuchungen stammt von Burton et al. (2006). In dieser doppelblinden, placebokontrollierten Studie nahmen 23 Teilnehmer mit chronischer Halitosis über sieben Tage K12-Lutschtabletten ein. Bereits nach einer Woche zeigte sich eine signifikante Reduktion der VSC-Werte um über 85 Prozent, während die Placebogruppe keine wesentliche Veränderung zeigte.
Eine Folgestudie mit 28 Probanden bestätigte diesen Effekt über einen Zeitraum von 30 Tagen. Interessant war, dass die Wirksamkeit deutlich höher war, wenn die Teilnehmer vor Beginn der Behandlung eine Zungenreinigung durchgeführt hatten – ein Hinweis darauf, dass Probiotika auf einer sauberen Oberfläche besser kolonisieren.
Auch für M18 liegen klinische Daten vor. In einer italienischen Doppelblindstudie (Di Pierro et al., 2023) führte die tägliche Einnahme von M18-Lutschtabletten über acht Wochen zu einer signifikanten Verbesserung der Gingiva-Indizes und einer Reduktion von Zahnbelägen. Subjektiv berichteten die Teilnehmer auch über frischeren Atem.
In vitro-Versuche zeigten ergänzend, dass K12 und M18 die Produktion von Proteasen wie RgpA bei Porphyromonas gingivalis hemmen – Enzyme, die nicht nur das Gewebe zerstören, sondern auch die Bildung von VSCs verstärken.
Insgesamt ergibt sich ein konsistentes Bild: Probiotische Streptokokken wirken über direkte antimikrobielle Effekte, Modulation des lokalen Immunsystems und Verbesserung der oralen Mikroumgebung.
Übersicht der wichtigsten Studien
| Studie (Jahr) | Teilnehmer | Probiotikum | Studiendesign | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Burton et al. (2006) | 23 | S. salivariusK12 | Doppelblind, Placebo, 7 Tage | Reduktion der VSCs um >85 %, 85 % klinische Verbesserung |
| Ouwehand et al. (2013) | 28 | S. salivariusK12 | 30 Tage, mit/ohne Zungenreinigung | Signifikant bessere Ergebnisse bei gereinigter Zunge |
| Di Pierro et al. (2023) | 60 | S. salivariusM18 | Doppelblind, 8 Wochen | Verringerte Gingivitis und Plaque, frischer Atem |
| Matsumoto et al. (2021) | In vitro | K12 & M18 | Laboruntersuchung | Hemmung von VSC-Bildung, Reduktion bakterieller Proteasen |
Diese Daten zeigen, dass die Wirkung sowohl kurz- als auch langfristig beobachtbar ist. Besonders K12 entfaltet schon nach wenigen Tagen messbare Effekte, während M18 zusätzlich strukturelle Verbesserungen im oralen Biofilm fördert.
Praktische Anwendung und Grenzen
Probiotische Therapie ist keine Wundermedizin, sondern Teil eines ganzheitlichen Ansatzes. Damit K12 oder M18 ihre Wirkung entfalten können, sollte die Mundhöhle zuvor mechanisch gereinigt sein – insbesondere die Zunge. Eine tägliche Anwendung über mindestens zwei bis vier Wochen ist sinnvoll, um eine stabile Kolonisation zu ermöglichen.
Die meisten Präparate werden als Lutschtabletten angeboten, die abends nach dem Zähneputzen langsam im Mund zergehen. Wichtig ist, danach nichts mehr zu essen oder zu trinken, damit die Bakterien Zeit haben, sich anzusiedeln.
Nebenwirkungen sind äußerst selten; gelegentlich berichten Anwender über ein leichtes Kribbeln oder vorübergehendes Trockenheitsgefühl. Da Streptococcus salivarius natürlicher Bestandteil der oralen Flora ist, gilt er als sicher – auch bei längerer Anwendung.
Grenzen ergeben sich bei systemischen Ursachen von Mundgeruch, etwa Magen- oder Nasennebenhöhlenerkrankungen. In diesen Fällen können Probiotika zwar ergänzen, aber nicht die Grundursache beheben.
Fazit – kleine Bakterien, große Wirkung
Die Forschung der letzten Jahre zeigt klar: Probiotika sind mehr als ein Wellness-Trend. Besonders Streptococcus salivarius K12 und M18 haben das Potenzial, Mundgeruch an seiner Wurzel zu bekämpfen – im Mikrobiom selbst.
Sie wirken gezielt gegen die Bakterien, die flüchtige Schwefelverbindungen bilden, und helfen gleichzeitig, Zahnfleisch und Zähne gesund zu halten.
Die klinische Basis ist solide: randomisierte, placebokontrollierte Studien, deutliche VSC-Reduktionen und nachweisbare Veränderungen in der Mundflora.
Natürlich ersetzt ein Probiotikum keine gute Mundhygiene – aber es kann sie auf intelligente Weise ergänzen.
Wer unter hartnäckigem Mundgeruch leidet, sollte neben Zungenreinigung, Speichelförderung und zahnärztlicher Kontrolle auch den Einsatz oraler Probiotika in Betracht ziehen.
K12 und M18 sind wissenschaftlich gut untersucht, sicher und eröffnen einen neuen, biologisch orientierten Weg zu frischem Atem – und damit zu mehr Wohlbefinden im Alltag.