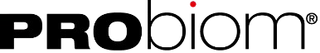Wenn im Frühling die Nase läuft und die Augen jucken, denken viele sofort an Birken- oder Gräserpollen. Doch in den letzten Jahren sorgt eine weitere Pflanze zunehmend für Probleme: Ambrosia artemisiifolia, auch Beifußblättriges Traubenkraut genannt. Diese unscheinbare Pflanze ist ein Spätblüher, der von Juli bis Oktober Unmengen an Pollen in die Luft schleudert. Das Gefährliche daran: Schon winzige Mengen reichen aus, um heftige allergische Reaktionen auszulösen. Millionen Menschen in Europa sind inzwischen betroffen – Tendenz steigend.
Was ist Ambrosia eigentlich?
Ambrosia stammt ursprünglich aus Nordamerika und gelangte vermutlich im 19. Jahrhundert mit verunreinigtem Saatgut und Tierfutter nach Europa. Heute ist sie besonders in Frankreich, Ungarn, Italien, Österreich und Deutschland weit verbreitet. Die Pflanze wächst bevorzugt an Straßenrändern, Baustellen oder Brachflächen, also überall dort, wo der Boden regelmäßig gestört wird.
Optisch wirkt sie unscheinbar: grüne, tief eingeschnittene Blätter, stark verzweigte Stängel und eine Wuchshöhe von 30 bis 150 Zentimetern. Erst bei genauerem Hinsehen erkennt man die kleinen, grünlichen Blütenstände. Während die meisten allergieauslösenden Pflanzen im Frühjahr blühen, beginnt Ambrosia erst im Hochsommer und hält bis in den Herbst hinein durch.
Die Ausbreitung in Deutschland und Europa
Dass Ambrosia in Europa so schnell Fuß fassen konnte, liegt nicht nur an ihrem hohen Anpassungsvermögen, sondern auch am Klimawandel. Längere warme Perioden und milde Winter begünstigen ihre Verbreitung. Hinzu kommen Transporte über Tierfutter, Saatgut oder Baustellen. Besonders stark betroffen sind Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg und Hessen, doch auch in anderen Bundesländern nimmt die Zahl der Bestände stetig zu.
Ein Problem ist die Unkenntnis vieler Bürgerinnen und Bürger. Wer die Pflanze nicht erkennt, entfernt sie nicht rechtzeitig – und so breitet sie sich weiter aus.
Warum Ambrosia so gefährlich ist
Die große Gefahr liegt in der extremen Allergenität. Schon fünf bis zehn Pollenkörner pro Kubikmeter Luft können bei empfindlichen Menschen Symptome auslösen. Zum Vergleich: Bei Gräsern braucht es mindestens die zehnfache Menge. Da Ambrosia so spät blüht, verlängert sie die Leidenszeit vieler Allergiker erheblich. Wer bereits unter Heuschnupfen im Frühjahr leidet, wird oft auch im Spätsommer erneut geplagt. Manche entwickeln sogar erstmals eine Allergie, obwohl sie zuvor beschwerdefrei waren.
Besonders problematisch ist das hohe Risiko für allergisches Asthma. Ambrosia-Pollen gelangen tief in die Atemwege und können dort chronische Entzündungen hervorrufen. Studien zeigen, dass Betroffene deutlich häufiger Asthma entwickeln als bei anderen Pollenallergien.
Symptome einer Ambrosia-Allergie
Die Beschwerden sind vielfältig: eine laufende oder verstopfte Nase, Niesanfälle, rote und juckende Augen sowie Atemprobleme gehören zu den häufigsten. Manche Betroffene berichten zusätzlich von Hautausschlägen, Juckreiz oder Kopfschmerzen. Nicht selten fühlen sie sich müde, abgeschlagen und weniger leistungsfähig.
Ein weiteres Phänomen sind Kreuzallergien. Ambrosia-Allergiker reagieren oft auch auf bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel auf Sellerie, Melonen, Gurken oder Bananen. Schon kleine Mengen können dann Juckreiz im Mund oder Schwellungen verursachen.
Diagnose beim Allergologen
Wer im Spätsommer regelmäßig unter den genannten Symptomen leidet, sollte unbedingt einen Allergologen aufsuchen. Mithilfe eines Pricktests auf der Haut oder spezieller Blutuntersuchungen lässt sich eine Ambrosia-Allergie eindeutig nachweisen. In manchen Fällen wird zusätzlich ein Provokationstest durchgeführt, bei dem der Patient unter kontrollierten Bedingungen mit dem Allergen in Kontakt kommt.
Eine gesicherte Diagnose ist wichtig, um Folgeerkrankungen wie Asthma frühzeitig zu erkennen und gezielt behandeln zu können.
Behandlungsmöglichkeiten
Die Therapie gliedert sich in zwei Bereiche: kurzfristige Linderung und langfristige Ursachenbehandlung.
Für die schnelle Hilfe kommen meist Antihistaminika in Tablettenform zum Einsatz, die Juckreiz, Niesen und tränende Augen reduzieren. Nasensprays mit Kortison wirken gegen entzündete Schleimhäute, während Augentropfen das Brennen in den Augen lindern. Bei Beteiligung der unteren Atemwege verordnen Ärzte zusätzlich Asthmamedikamente.
Die einzige ursächliche Therapie ist die Hyposensibilisierung. Dabei wird der Körper über mehrere Jahre hinweg mit steigenden Dosen des Ambrosia-Allergens konfrontiert. Ziel ist es, eine Toleranz aufzubauen und die Beschwerden dauerhaft zu reduzieren. Studien zeigen, dass diese Methode bei Ambrosia-Allergien besonders erfolgreich sein kann.
Vorbeugung im Alltag
Auch wenn Medikamente helfen, spielt das eigene Verhalten eine große Rolle. Allergiker sollten während der Blütezeit Pollenkalender nutzen und besonders an trockenen, windigen Tagen Aktivitäten im Freien reduzieren. Wer draußen war, sollte Kleidung wechseln und duschen, um die Pollen von Haut und Haaren zu entfernen. In Wohnräumen helfen Pollenschutzgitter und regelmäßiges Staubsaugen mit HEPA-Filter. Spaziergänge sind nach Regen am angenehmsten, da die Luft dann weitgehend pollenfrei ist.
Doch nicht nur Betroffene selbst können etwas tun. Jeder, der Ambrosia entdeckt, sollte die Pflanze noch vor der Blüte mitsamt Wurzel entfernen – idealerweise mit Handschuhen und Mundschutz, da auch Hautkontakt und Einatmen der Pollen Reizungen hervorrufen können. In vielen Bundesländern gibt es Meldestellen, an die man größere Bestände weitergeben kann.
Gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen
Die gesundheitlichen Probleme durch Ambrosia haben auch ökonomische Auswirkungen. Mit steigender Zahl an Allergikern steigen die Kosten für Medikamente, Arztbesuche und Therapien. Zudem führen starke Symptome zu Arbeitsausfällen und geringerer Produktivität.
Auch die Landwirtschaft ist betroffen: Ambrosia kann Felder verunkrauten und die Erträge von Nutzpflanzen wie Sonnenblumen, Mais oder Soja mindern. Einige Länder wie Ungarn haben deshalb bereits gesetzliche Regelungen zur Ambrosiabekämpfung eingeführt.
Klimawandel als Verstärker
Dass Ambrosia heute eine so große Rolle spielt, hängt auch mit dem Klimawandel zusammen. Längere Vegetationszeiten und höhere CO₂-Konzentrationen fördern das Wachstum und die Pollenproduktion. Gleichzeitig breitet sich die Pflanze in Regionen aus, die früher zu kühl waren. Experten befürchten, dass sich die Belastung in Europa in den kommenden Jahrzehnten verdoppeln oder sogar verdreifachen könnte, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
Was jetzt getan werden muss
Die Bekämpfung von Ambrosia ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Aufklärung ist dabei ein zentraler Punkt: Je mehr Menschen die Pflanze erkennen, desto leichter lässt sie sich eindämmen. Gemeinden und Straßenmeistereien sollten bekannte Bestände konsequent entfernen, bevor sie in die Blüte gehen. Auch europaweite Strategien sind nötig, denn Pollen kennen keine Landesgrenzen. Gleichzeitig braucht es mehr Forschung, um neue Therapieansätze und effektive Monitoring-Systeme zu entwickeln.
Fazit
Ambrosia ist längst mehr als ein harmloses „Unkraut“. Sie ist einer der aggressivsten Allergieauslöser in Europa und stellt eine wachsende Herausforderung für die Gesundheitssysteme dar. Ihre lange Blütezeit, die enorme Pollenproduktion und die enge Verbindung zum Klimawandel machen sie zu einem Problem, das wir nur gemeinsam in den Griff bekommen können.
Die gute Nachricht: Jeder kann etwas beitragen – sei es durch das Entfernen einzelner Pflanzen im eigenen Garten, durch die Meldung von Beständen oder durch den bewussten Umgang mit der eigenen Allergie. Je früher wir handeln, desto besser lässt sich die Ausbreitung eindämmen und die Belastung für Millionen Menschen reduzieren.